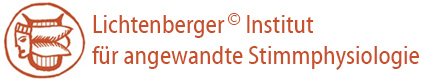Ausgangspunkt war 1980 ein Forschungsprojekt am Institut für Arbeitswissenschaft der TU Darmstadt. Das IAD war von Prof. Dr. Ing. Walter Rohmert aufgebaut und über 15 Jahre geleitet worden.
Das Lichtenberger Institut wurde 1982 durch die Sängerin und Gesangspädagogin Gisela Rohmert und Prof. Walter Rohmert gegründet. Es folgten Forschung und Methodenentwicklung durch ein Expertenteam am Haus, zu welchem seit der Gründung das Ehepaar Johanna Rohmert-Landzettel (Sängerin, Geigerin, Feldenkrais Practitioner) und Martin Landzettel (Geiger) gehören. Diese übernahmen 2002 die Leitung des Instituts.
Zielsetzung ist die Symbiose aus Wissenschaft und Kunst mit dem Anspruch, neue Erkenntnisse aus der Gesangs– und Instrumentalforschung zu gewinnen und in die Praxis umzusetzen.
Mittels umfangreicher physiologischer und akustischer Messmethoden wurden die Vorgänge bei Gesang und Instrumentalspiel erfasst. Zahlreiche Körpertechniken und physiologische Modelle wurden in ihrer Wirkung auf den Stimmklang untersucht. Auf der Grundlage einer gesunden Kehlkopffunktion konnten der menschlichen Stimme die Eigenschaften Freiheit und Leichtigkeit des Singens, großer Stimmumfang und weitgehende Altersunabhängigkeit zugesprochen werden. Ein erweitertes Verständnis der Beziehung des sensorischen Nervensystems zum Klang führte zu einem neuen Ansatz in der Stimm– und Instrumentalpädagogik.
Dieser neue Forschungsansatz war maßgeblich für die Gründung des Lichtenberger Instituts im Jahr 1982. Das neue Institut bot als Zweigstelle des IAD den idealen Rahmen für praktische Feldversuche. Theoretische Hypothesen und Erkenntnisse konnten direkt anhand vieler Sängerinnen und Sänger, die sich gerne dem Institut als Testpersonen zur Verfügung stellten, praktisch überprüft werden. Die enge Verzahnung mit der Wissenschaft war von Beginn an ein entscheidendes Merkmal des Instituts.
In seinen Anfangsjahren wurde das neue Institut nicht nur gelobt, sondern auch kritisiert. Neue Ansätze und Erkenntnisse setzen sich jedoch in der Wissenschaft und gerade auch in der Kunst nur selten unmittelbar durch. Daher benötigte das Institut für seine langfristig angelegte Forschung einen langen Atem. Die Offenheit vieler Sängerinnen und Sänger für die neuen Ideen und Ansätze waren hierbei für das Institut sehr hilfreich und überlebenswichtig. Viele der Testpersonen des Instituts erkannten für sich bzw. für ihre Berufsgruppe den Nutzen, der schließlich auch in empirischen Langzeitstudien belegt werden konnte. Aus einigen begeisterten Probanden wurden später auch Mitarbeiter des Instituts.
Prof. Rohmert blieb über viele Jahre als Forscher und auch als Mäzen für das Institut von entscheidender Bedeutung. Besonders seine engen Kontakte zur TU Darmstadt waren hierbei unentbehrlich. Mit seiner Tatkraft und seiner wissenschaftlichen Lauterkeit war er maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Institut in Fachkreisen und darüber hinaus an Ansehen und Bedeutung gewann und sich zunehmend als anerkannte Adresse etablieren konnte. Sein Tod nach langer und schwerer Erkrankung im Jahr 2009 war ein schwerer Schlag. Jedoch war es inzwischen gelungen, den eigenen Forschungsansatz und das Lichtenberger Institut längst so zu etablieren, dass das Institut auch ohne seinen Gründer erfolgreich fort bestehen und seine Arbeit in Prof. Rohmerts Sinne weiterführen konnte und wird.